Publikationen
Die Ergebnisse seiner Forschungsarbeit veröffentlicht das IKEM regelmäßig in Form von Studien, Stellungnahmen und Beiträgen in renommierten Journals.
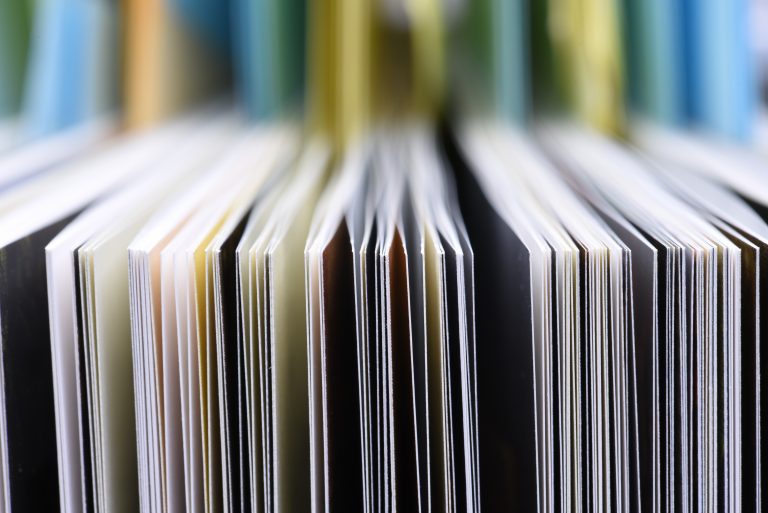 Quelle: stock.adobe.com
Quelle: stock.adobe.com Neueste Veröffentlichungen
Publikationsdatenbank
Um9ib3RvOnJlZ3VsYXI=
LnRiLWJ1dHRvbntjb2xvcjojZjFmMWYxfS50Yi1idXR0b24tLWxlZnR7dGV4dC1hbGlnbjpsZWZ0fS50Yi1idXR0b24tLWNlbnRlcnt0ZXh0LWFsaWduOmNlbnRlcn0udGItYnV0dG9uLS1yaWdodHt0ZXh0LWFsaWduOnJpZ2h0fS50Yi1idXR0b25fX2xpbmt7Y29sb3I6aW5oZXJpdDtjdXJzb3I6cG9pbnRlcjtkaXNwbGF5OmlubGluZS1ibG9jaztsaW5lLWhlaWdodDoxMDAlO3RleHQtZGVjb3JhdGlvbjpub25lICFpbXBvcnRhbnQ7dGV4dC1hbGlnbjpjZW50ZXI7dHJhbnNpdGlvbjphbGwgMC4zcyBlYXNlfS50Yi1idXR0b25fX2xpbms6aG92ZXIsLnRiLWJ1dHRvbl9fbGluazpmb2N1cywudGItYnV0dG9uX19saW5rOnZpc2l0ZWR7Y29sb3I6aW5oZXJpdH0udGItYnV0dG9uX19saW5rOmhvdmVyIC50Yi1idXR0b25fX2NvbnRlbnQsLnRiLWJ1dHRvbl9fbGluazpmb2N1cyAudGItYnV0dG9uX19jb250ZW50LC50Yi1idXR0b25fX2xpbms6dmlzaXRlZCAudGItYnV0dG9uX19jb250ZW50e2ZvbnQtZmFtaWx5OmluaGVyaXQ7Zm9udC1zdHlsZTppbmhlcml0O2ZvbnQtd2VpZ2h0OmluaGVyaXQ7bGV0dGVyLXNwYWNpbmc6aW5oZXJpdDt0ZXh0LWRlY29yYXRpb246aW5oZXJpdDt0ZXh0LXNoYWRvdzppbmhlcml0O3RleHQtdHJhbnNmb3JtOmluaGVyaXR9LnRiLWJ1dHRvbl9fY29udGVudHt2ZXJ0aWNhbC1hbGlnbjptaWRkbGU7dHJhbnNpdGlvbjphbGwgMC4zcyBlYXNlfS50Yi1idXR0b25fX2ljb257dHJhbnNpdGlvbjphbGwgMC4zcyBlYXNlO2Rpc3BsYXk6aW5saW5lLWJsb2NrO3ZlcnRpY2FsLWFsaWduOm1pZGRsZTtmb250LXN0eWxlOm5vcm1hbCAhaW1wb3J0YW50fS50Yi1idXR0b25fX2ljb246OmJlZm9yZXtjb250ZW50OmF0dHIoZGF0YS1mb250LWNvZGUpO2ZvbnQtd2VpZ2h0Om5vcm1hbCAhaW1wb3J0YW50fS50Yi1idXR0b25fX2xpbmt7YmFja2dyb3VuZC1jb2xvcjojNDQ0O2JvcmRlci1yYWRpdXM6MC4zZW07Zm9udC1zaXplOjEuM2VtO21hcmdpbi1ib3R0b206MC43NmVtO3BhZGRpbmc6MC41NWVtIDEuNWVtIDAuNTVlbX0gLnRiLWJ1dHRvbltkYXRhLXRvb2xzZXQtYmxvY2tzLWJ1dHRvbj0iMTJjNjZjY2M2ZjRkMThiMzA3MGViMjAzYWVjNWY0MDkiXSB7IHRleHQtYWxpZ246IGNlbnRlcjsgfSAudGItYnV0dG9uW2RhdGEtdG9vbHNldC1ibG9ja3MtYnV0dG9uPSIxMmM2NmNjYzZmNGQxOGIzMDcwZWIyMDNhZWM1ZjQwOSJdIC50Yi1idXR0b25fX2xpbmsgeyBiYWNrZ3JvdW5kLWNvbG9yOiByZ2JhKCAyNTUsIDI1NSwgMjU1LCAxICk7Ym9yZGVyLXJhZGl1czogMjNweDtjb2xvcjogcmdiYSggMCwgMTAxLCAxNDksIDEgKTtib3JkZXI6IDFweCBzb2xpZCByZ2JhKCAwLCAxMDEsIDE0OSwgMSApO2ZvbnQtc2l6ZTogMTZweDtmb250LWZhbWlseTogUm9ib3RvO2ZvbnQtd2VpZ2h0OiByZWd1bGFyO2NvbG9yOiByZ2JhKCAwLCAxMDEsIDE0OSwgMSApOyB9IEBtZWRpYSBvbmx5IHNjcmVlbiBhbmQgKG1heC13aWR0aDogNzgxcHgpIHsgLnRiLWJ1dHRvbntjb2xvcjojZjFmMWYxfS50Yi1idXR0b24tLWxlZnR7dGV4dC1hbGlnbjpsZWZ0fS50Yi1idXR0b24tLWNlbnRlcnt0ZXh0LWFsaWduOmNlbnRlcn0udGItYnV0dG9uLS1yaWdodHt0ZXh0LWFsaWduOnJpZ2h0fS50Yi1idXR0b25fX2xpbmt7Y29sb3I6aW5oZXJpdDtjdXJzb3I6cG9pbnRlcjtkaXNwbGF5OmlubGluZS1ibG9jaztsaW5lLWhlaWdodDoxMDAlO3RleHQtZGVjb3JhdGlvbjpub25lICFpbXBvcnRhbnQ7dGV4dC1hbGlnbjpjZW50ZXI7dHJhbnNpdGlvbjphbGwgMC4zcyBlYXNlfS50Yi1idXR0b25fX2xpbms6aG92ZXIsLnRiLWJ1dHRvbl9fbGluazpmb2N1cywudGItYnV0dG9uX19saW5rOnZpc2l0ZWR7Y29sb3I6aW5oZXJpdH0udGItYnV0dG9uX19saW5rOmhvdmVyIC50Yi1idXR0b25fX2NvbnRlbnQsLnRiLWJ1dHRvbl9fbGluazpmb2N1cyAudGItYnV0dG9uX19jb250ZW50LC50Yi1idXR0b25fX2xpbms6dmlzaXRlZCAudGItYnV0dG9uX19jb250ZW50e2ZvbnQtZmFtaWx5OmluaGVyaXQ7Zm9udC1zdHlsZTppbmhlcml0O2ZvbnQtd2VpZ2h0OmluaGVyaXQ7bGV0dGVyLXNwYWNpbmc6aW5oZXJpdDt0ZXh0LWRlY29yYXRpb246aW5oZXJpdDt0ZXh0LXNoYWRvdzppbmhlcml0O3RleHQtdHJhbnNmb3JtOmluaGVyaXR9LnRiLWJ1dHRvbl9fY29udGVudHt2ZXJ0aWNhbC1hbGlnbjptaWRkbGU7dHJhbnNpdGlvbjphbGwgMC4zcyBlYXNlfS50Yi1idXR0b25fX2ljb257dHJhbnNpdGlvbjphbGwgMC4zcyBlYXNlO2Rpc3BsYXk6aW5saW5lLWJsb2NrO3ZlcnRpY2FsLWFsaWduOm1pZGRsZTtmb250LXN0eWxlOm5vcm1hbCAhaW1wb3J0YW50fS50Yi1idXR0b25fX2ljb246OmJlZm9yZXtjb250ZW50OmF0dHIoZGF0YS1mb250LWNvZGUpO2ZvbnQtd2VpZ2h0Om5vcm1hbCAhaW1wb3J0YW50fS50Yi1idXR0b25fX2xpbmt7YmFja2dyb3VuZC1jb2xvcjojNDQ0O2JvcmRlci1yYWRpdXM6MC4zZW07Zm9udC1zaXplOjEuM2VtO21hcmdpbi1ib3R0b206MC43NmVtO3BhZGRpbmc6MC41NWVtIDEuNWVtIDAuNTVlbX0gLnRiLWJ1dHRvbltkYXRhLXRvb2xzZXQtYmxvY2tzLWJ1dHRvbj0iMTJjNjZjY2M2ZjRkMThiMzA3MGViMjAzYWVjNWY0MDkiXSB7IHRleHQtYWxpZ246IHJpZ2h0OyB9ICB9IEBtZWRpYSBvbmx5IHNjcmVlbiBhbmQgKG1heC13aWR0aDogNTk5cHgpIHsgLnRiLWJ1dHRvbntjb2xvcjojZjFmMWYxfS50Yi1idXR0b24tLWxlZnR7dGV4dC1hbGlnbjpsZWZ0fS50Yi1idXR0b24tLWNlbnRlcnt0ZXh0LWFsaWduOmNlbnRlcn0udGItYnV0dG9uLS1yaWdodHt0ZXh0LWFsaWduOnJpZ2h0fS50Yi1idXR0b25fX2xpbmt7Y29sb3I6aW5oZXJpdDtjdXJzb3I6cG9pbnRlcjtkaXNwbGF5OmlubGluZS1ibG9jaztsaW5lLWhlaWdodDoxMDAlO3RleHQtZGVjb3JhdGlvbjpub25lICFpbXBvcnRhbnQ7dGV4dC1hbGlnbjpjZW50ZXI7dHJhbnNpdGlvbjphbGwgMC4zcyBlYXNlfS50Yi1idXR0b25fX2xpbms6aG92ZXIsLnRiLWJ1dHRvbl9fbGluazpmb2N1cywudGItYnV0dG9uX19saW5rOnZpc2l0ZWR7Y29sb3I6aW5oZXJpdH0udGItYnV0dG9uX19saW5rOmhvdmVyIC50Yi1idXR0b25fX2NvbnRlbnQsLnRiLWJ1dHRvbl9fbGluazpmb2N1cyAudGItYnV0dG9uX19jb250ZW50LC50Yi1idXR0b25fX2xpbms6dmlzaXRlZCAudGItYnV0dG9uX19jb250ZW50e2ZvbnQtZmFtaWx5OmluaGVyaXQ7Zm9udC1zdHlsZTppbmhlcml0O2ZvbnQtd2VpZ2h0OmluaGVyaXQ7bGV0dGVyLXNwYWNpbmc6aW5oZXJpdDt0ZXh0LWRlY29yYXRpb246aW5oZXJpdDt0ZXh0LXNoYWRvdzppbmhlcml0O3RleHQtdHJhbnNmb3JtOmluaGVyaXR9LnRiLWJ1dHRvbl9fY29udGVudHt2ZXJ0aWNhbC1hbGlnbjptaWRkbGU7dHJhbnNpdGlvbjphbGwgMC4zcyBlYXNlfS50Yi1idXR0b25fX2ljb257dHJhbnNpdGlvbjphbGwgMC4zcyBlYXNlO2Rpc3BsYXk6aW5saW5lLWJsb2NrO3ZlcnRpY2FsLWFsaWduOm1pZGRsZTtmb250LXN0eWxlOm5vcm1hbCAhaW1wb3J0YW50fS50Yi1idXR0b25fX2ljb246OmJlZm9yZXtjb250ZW50OmF0dHIoZGF0YS1mb250LWNvZGUpO2ZvbnQtd2VpZ2h0Om5vcm1hbCAhaW1wb3J0YW50fS50Yi1idXR0b25fX2xpbmt7YmFja2dyb3VuZC1jb2xvcjojNDQ0O2JvcmRlci1yYWRpdXM6MC4zZW07Zm9udC1zaXplOjEuM2VtO21hcmdpbi1ib3R0b206MC43NmVtO3BhZGRpbmc6MC41NWVtIDEuNWVtIDAuNTVlbX0gLnRiLWJ1dHRvbltkYXRhLXRvb2xzZXQtYmxvY2tzLWJ1dHRvbj0iMTJjNjZjY2M2ZjRkMThiMzA3MGViMjAzYWVjNWY0MDkiXSB7IHRleHQtYWxpZ246IGNlbnRlcjsgfSAgfSA=
Um9ib3RvOnJlZ3VsYXI=
LnRiLWJ1dHRvbntjb2xvcjojZjFmMWYxfS50Yi1idXR0b24tLWxlZnR7dGV4dC1hbGlnbjpsZWZ0fS50Yi1idXR0b24tLWNlbnRlcnt0ZXh0LWFsaWduOmNlbnRlcn0udGItYnV0dG9uLS1yaWdodHt0ZXh0LWFsaWduOnJpZ2h0fS50Yi1idXR0b25fX2xpbmt7Y29sb3I6aW5oZXJpdDtjdXJzb3I6cG9pbnRlcjtkaXNwbGF5OmlubGluZS1ibG9jaztsaW5lLWhlaWdodDoxMDAlO3RleHQtZGVjb3JhdGlvbjpub25lICFpbXBvcnRhbnQ7dGV4dC1hbGlnbjpjZW50ZXI7dHJhbnNpdGlvbjphbGwgMC4zcyBlYXNlfS50Yi1idXR0b25fX2xpbms6aG92ZXIsLnRiLWJ1dHRvbl9fbGluazpmb2N1cywudGItYnV0dG9uX19saW5rOnZpc2l0ZWR7Y29sb3I6aW5oZXJpdH0udGItYnV0dG9uX19saW5rOmhvdmVyIC50Yi1idXR0b25fX2NvbnRlbnQsLnRiLWJ1dHRvbl9fbGluazpmb2N1cyAudGItYnV0dG9uX19jb250ZW50LC50Yi1idXR0b25fX2xpbms6dmlzaXRlZCAudGItYnV0dG9uX19jb250ZW50e2ZvbnQtZmFtaWx5OmluaGVyaXQ7Zm9udC1zdHlsZTppbmhlcml0O2ZvbnQtd2VpZ2h0OmluaGVyaXQ7bGV0dGVyLXNwYWNpbmc6aW5oZXJpdDt0ZXh0LWRlY29yYXRpb246aW5oZXJpdDt0ZXh0LXNoYWRvdzppbmhlcml0O3RleHQtdHJhbnNmb3JtOmluaGVyaXR9LnRiLWJ1dHRvbl9fY29udGVudHt2ZXJ0aWNhbC1hbGlnbjptaWRkbGU7dHJhbnNpdGlvbjphbGwgMC4zcyBlYXNlfS50Yi1idXR0b25fX2ljb257dHJhbnNpdGlvbjphbGwgMC4zcyBlYXNlO2Rpc3BsYXk6aW5saW5lLWJsb2NrO3ZlcnRpY2FsLWFsaWduOm1pZGRsZTtmb250LXN0eWxlOm5vcm1hbCAhaW1wb3J0YW50fS50Yi1idXR0b25fX2ljb246OmJlZm9yZXtjb250ZW50OmF0dHIoZGF0YS1mb250LWNvZGUpO2ZvbnQtd2VpZ2h0Om5vcm1hbCAhaW1wb3J0YW50fS50Yi1idXR0b25fX2xpbmt7YmFja2dyb3VuZC1jb2xvcjojNDQ0O2JvcmRlci1yYWRpdXM6MC4zZW07Zm9udC1zaXplOjEuM2VtO21hcmdpbi1ib3R0b206MC43NmVtO3BhZGRpbmc6MC41NWVtIDEuNWVtIDAuNTVlbX0gLnRiLWJ1dHRvbltkYXRhLXRvb2xzZXQtYmxvY2tzLWJ1dHRvbj0iMTJjNjZjY2M2ZjRkMThiMzA3MGViMjAzYWVjNWY0MDkiXSB7IHRleHQtYWxpZ246IGNlbnRlcjsgfSAudGItYnV0dG9uW2RhdGEtdG9vbHNldC1ibG9ja3MtYnV0dG9uPSIxMmM2NmNjYzZmNGQxOGIzMDcwZWIyMDNhZWM1ZjQwOSJdIC50Yi1idXR0b25fX2xpbmsgeyBiYWNrZ3JvdW5kLWNvbG9yOiByZ2JhKCAyNTUsIDI1NSwgMjU1LCAxICk7Ym9yZGVyLXJhZGl1czogMjNweDtjb2xvcjogcmdiYSggMCwgMTAxLCAxNDksIDEgKTtib3JkZXI6IDFweCBzb2xpZCByZ2JhKCAwLCAxMDEsIDE0OSwgMSApO2ZvbnQtc2l6ZTogMTZweDtmb250LWZhbWlseTogUm9ib3RvO2ZvbnQtd2VpZ2h0OiByZWd1bGFyO2NvbG9yOiByZ2JhKCAwLCAxMDEsIDE0OSwgMSApOyB9IEBtZWRpYSBvbmx5IHNjcmVlbiBhbmQgKG1heC13aWR0aDogNzgxcHgpIHsgLnRiLWJ1dHRvbntjb2xvcjojZjFmMWYxfS50Yi1idXR0b24tLWxlZnR7dGV4dC1hbGlnbjpsZWZ0fS50Yi1idXR0b24tLWNlbnRlcnt0ZXh0LWFsaWduOmNlbnRlcn0udGItYnV0dG9uLS1yaWdodHt0ZXh0LWFsaWduOnJpZ2h0fS50Yi1idXR0b25fX2xpbmt7Y29sb3I6aW5oZXJpdDtjdXJzb3I6cG9pbnRlcjtkaXNwbGF5OmlubGluZS1ibG9jaztsaW5lLWhlaWdodDoxMDAlO3RleHQtZGVjb3JhdGlvbjpub25lICFpbXBvcnRhbnQ7dGV4dC1hbGlnbjpjZW50ZXI7dHJhbnNpdGlvbjphbGwgMC4zcyBlYXNlfS50Yi1idXR0b25fX2xpbms6aG92ZXIsLnRiLWJ1dHRvbl9fbGluazpmb2N1cywudGItYnV0dG9uX19saW5rOnZpc2l0ZWR7Y29sb3I6aW5oZXJpdH0udGItYnV0dG9uX19saW5rOmhvdmVyIC50Yi1idXR0b25fX2NvbnRlbnQsLnRiLWJ1dHRvbl9fbGluazpmb2N1cyAudGItYnV0dG9uX19jb250ZW50LC50Yi1idXR0b25fX2xpbms6dmlzaXRlZCAudGItYnV0dG9uX19jb250ZW50e2ZvbnQtZmFtaWx5OmluaGVyaXQ7Zm9udC1zdHlsZTppbmhlcml0O2ZvbnQtd2VpZ2h0OmluaGVyaXQ7bGV0dGVyLXNwYWNpbmc6aW5oZXJpdDt0ZXh0LWRlY29yYXRpb246aW5oZXJpdDt0ZXh0LXNoYWRvdzppbmhlcml0O3RleHQtdHJhbnNmb3JtOmluaGVyaXR9LnRiLWJ1dHRvbl9fY29udGVudHt2ZXJ0aWNhbC1hbGlnbjptaWRkbGU7dHJhbnNpdGlvbjphbGwgMC4zcyBlYXNlfS50Yi1idXR0b25fX2ljb257dHJhbnNpdGlvbjphbGwgMC4zcyBlYXNlO2Rpc3BsYXk6aW5saW5lLWJsb2NrO3ZlcnRpY2FsLWFsaWduOm1pZGRsZTtmb250LXN0eWxlOm5vcm1hbCAhaW1wb3J0YW50fS50Yi1idXR0b25fX2ljb246OmJlZm9yZXtjb250ZW50OmF0dHIoZGF0YS1mb250LWNvZGUpO2ZvbnQtd2VpZ2h0Om5vcm1hbCAhaW1wb3J0YW50fS50Yi1idXR0b25fX2xpbmt7YmFja2dyb3VuZC1jb2xvcjojNDQ0O2JvcmRlci1yYWRpdXM6MC4zZW07Zm9udC1zaXplOjEuM2VtO21hcmdpbi1ib3R0b206MC43NmVtO3BhZGRpbmc6MC41NWVtIDEuNWVtIDAuNTVlbX0gLnRiLWJ1dHRvbltkYXRhLXRvb2xzZXQtYmxvY2tzLWJ1dHRvbj0iMTJjNjZjY2M2ZjRkMThiMzA3MGViMjAzYWVjNWY0MDkiXSB7IHRleHQtYWxpZ246IHJpZ2h0OyB9ICB9IEBtZWRpYSBvbmx5IHNjcmVlbiBhbmQgKG1heC13aWR0aDogNTk5cHgpIHsgLnRiLWJ1dHRvbntjb2xvcjojZjFmMWYxfS50Yi1idXR0b24tLWxlZnR7dGV4dC1hbGlnbjpsZWZ0fS50Yi1idXR0b24tLWNlbnRlcnt0ZXh0LWFsaWduOmNlbnRlcn0udGItYnV0dG9uLS1yaWdodHt0ZXh0LWFsaWduOnJpZ2h0fS50Yi1idXR0b25fX2xpbmt7Y29sb3I6aW5oZXJpdDtjdXJzb3I6cG9pbnRlcjtkaXNwbGF5OmlubGluZS1ibG9jaztsaW5lLWhlaWdodDoxMDAlO3RleHQtZGVjb3JhdGlvbjpub25lICFpbXBvcnRhbnQ7dGV4dC1hbGlnbjpjZW50ZXI7dHJhbnNpdGlvbjphbGwgMC4zcyBlYXNlfS50Yi1idXR0b25fX2xpbms6aG92ZXIsLnRiLWJ1dHRvbl9fbGluazpmb2N1cywudGItYnV0dG9uX19saW5rOnZpc2l0ZWR7Y29sb3I6aW5oZXJpdH0udGItYnV0dG9uX19saW5rOmhvdmVyIC50Yi1idXR0b25fX2NvbnRlbnQsLnRiLWJ1dHRvbl9fbGluazpmb2N1cyAudGItYnV0dG9uX19jb250ZW50LC50Yi1idXR0b25fX2xpbms6dmlzaXRlZCAudGItYnV0dG9uX19jb250ZW50e2ZvbnQtZmFtaWx5OmluaGVyaXQ7Zm9udC1zdHlsZTppbmhlcml0O2ZvbnQtd2VpZ2h0OmluaGVyaXQ7bGV0dGVyLXNwYWNpbmc6aW5oZXJpdDt0ZXh0LWRlY29yYXRpb246aW5oZXJpdDt0ZXh0LXNoYWRvdzppbmhlcml0O3RleHQtdHJhbnNmb3JtOmluaGVyaXR9LnRiLWJ1dHRvbl9fY29udGVudHt2ZXJ0aWNhbC1hbGlnbjptaWRkbGU7dHJhbnNpdGlvbjphbGwgMC4zcyBlYXNlfS50Yi1idXR0b25fX2ljb257dHJhbnNpdGlvbjphbGwgMC4zcyBlYXNlO2Rpc3BsYXk6aW5saW5lLWJsb2NrO3ZlcnRpY2FsLWFsaWduOm1pZGRsZTtmb250LXN0eWxlOm5vcm1hbCAhaW1wb3J0YW50fS50Yi1idXR0b25fX2ljb246OmJlZm9yZXtjb250ZW50OmF0dHIoZGF0YS1mb250LWNvZGUpO2ZvbnQtd2VpZ2h0Om5vcm1hbCAhaW1wb3J0YW50fS50Yi1idXR0b25fX2xpbmt7YmFja2dyb3VuZC1jb2xvcjojNDQ0O2JvcmRlci1yYWRpdXM6MC4zZW07Zm9udC1zaXplOjEuM2VtO21hcmdpbi1ib3R0b206MC43NmVtO3BhZGRpbmc6MC41NWVtIDEuNWVtIDAuNTVlbX0gLnRiLWJ1dHRvbltkYXRhLXRvb2xzZXQtYmxvY2tzLWJ1dHRvbj0iMTJjNjZjY2M2ZjRkMThiMzA3MGViMjAzYWVjNWY0MDkiXSB7IHRleHQtYWxpZ246IGNlbnRlcjsgfSAgfSA=
Severin Beuckert, Simon Großmann
Forderungen zur notwendigen Stärkung von Gebäudeautomation
Editorial. In: KlimR 04/2024. 2024.
Schäfer-Gendrisch, Judith
Wir brauchen eine richtungsweisende Regulierung
Editorial. In: KlimR 04/2024. 2024.
Hoffmann, Ilka; Eschweiler, Jana; Buchmüller, Christian; Wilms, Susan
QUARREE100 – Erkenntnisse und regulatorische Handlungsoptionen für die strombasierte Wärmeversorgung von Bestandsquartieren
Ergebnispapier in Zusammenarbeit des IKEM und der FH Westküste. 2024.





